Arbeitsbedingungen an Universitäten: Gerade noch den Absprung geschafft
Mitte 40 und immer noch befristet angestellt? An deutschen Unis normal. Drei Forscher sprechen über prekäre Forschung, Kipppunkte und Alternativen.
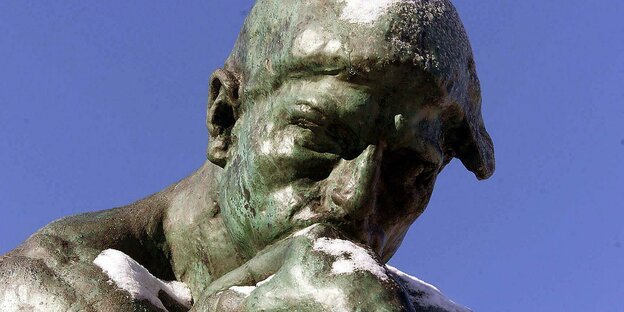
Würde auch gut an einer deutschen Uni stehen: ein Originalabguss der Skulptur „Der Denker“ von Auguste Rodin Foto: imago
Jan Süselbeck, 51, hat nach vielen befristeten Verträgen eine unbefristete Professur in Norwegen
Das deutsche Hochschulsystem ist im Eimer. Anders kann ich es nicht formulieren. Um hierzulande auf eine unbefristete Stelle zu kommen, muss man sehr, sehr viel arbeiten. Wer nicht bereit ist, seine Freizeit zu opfern und alles seiner Karriere unterzuordnen, hat eigentlich keine Chance. Ich war dazu bereit – und es hat trotzdem nicht gereicht. Irgendwann blieb nur mehr das Ausland.
Im Grund war ich immer prekär beschäftigt. In Berlin habe ich promoviert, ohne dafür eine Stelle zu haben. Das war eine harte Zeit, die ich mit Stipendien und kleinen Jobs überstanden habe. Meine Habilitation in Marburg dann habe ich vor allem frühmorgens und an Wochenenden geschrieben. Während meiner Arbeitszeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni hatte ich dafür keine Zeit. Da habe ich eine Literaturzeitschrift redaktionell verantwortet, das war ein Fulltime-Job.
Die genaue Zahl der Verträge, die ich über die Jahre angesammelt habe, kann ich nicht nennen, es waren viele. Ständig dreht man sich um die Frage: Wie geht es weiter? Wie zahle ich demnächst meine Miete? Die Zweifel, ob ich hier richtig bin, sind da ein ständiger Begleiter. Doch irgendwann habe ich gemerkt: Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Ich habe schon viel zu viel investiert. Vor allem wusste ich nicht, was ich sonst machen kann.
Meinen vielleicht größten Tiefpunkt hatte ich im Jahr 2020. Ich war damals bereits 47 und hatte wieder mal keine Ahnung, ob und wie es mit meiner wissenschaftlichen Karriere weitergehen würde. Zwei-, dreimal hätte es fast geklappt mit einer Professur, einmal bin ich auf Listenplatz zwei gelandet. Und die Stelle, die ich gerade über den DAAD fünf Jahre in Kanada innehatte, konnte leider auch nicht verlängert werden.
Und so bin ich mitten in der Pandemie nach Deutschland zurückgekehrt, nur mit einem DAAD-Rückkehrerstipendium für neun Monate, wie gesagt, mit 47 Jahren. Da fragte ich mich: War es das jetzt endgültig? Die zwölf Jahre, die ich laut Gesetz regulär an deutschen Hochschulen befristet angestellt sein darf, hatte ich da ja schon längst voll. Das war das Worst-Case-Szenario.
In der Zeit habe ich mich (wie schon die Jahre zuvor) intensiv um Stellen im Ausland beworben. Ich habe es versucht in Österreich und der Schweiz, in Belgien, den Niederlanden, Kanada, den USA, Großbritannien, Irland und Skandinavien. 2021 dann hat es tatsächlich noch geklappt. An der Uni Trondheim habe ich eine unbefristete Professur erhalten. Seither lebe und arbeite ich in Norwegen. Mit Worten ist das kaum zu beschreiben, welche Last von meinen Schultern gefallen ist.
Marco Valero Sanchez, 36, arbeitet heute in Hannover und Berlin in der Personalberatung
Fünf Jahre lang habe ich in der Wissenschaft gearbeitet. In dieser Zeit habe ich meinen Körper an den Rand des Abgrunds gebracht. Das klingt dramatisch – aber ehrlich gesagt war es das auch. Phasenweise habe ich meinen Körper nur mit Medikamenten am Laufen gehalten. Der ganze Stress, die ganze Unsicherheit, der ganze Druck haben sich bei mir körperlich und mental gezeigt: in Schlafstörungen, Panikattacken, verstärktem Haarausfall.
Ich hatte auch eine mittelschwere Depression. Kurz vor Abgabe meiner Promotionsschrift musste ich dann wegen akutem Blut- und Eisenmangel ins Krankenhaus. Vom Krankenhausbett aus habe ich noch weitergearbeitet. Ich musste ja fertig werden. Wie sehr ich meine Gesundheit diesem System untergeordnet habe, kommt mir heute im Rückblick ziemlich absurd vor.
Dazu muss man wissen: Ich habe eine chronische Erkrankung des Enddarms, bin Autist und ADHSler. Für mich heißt das, dass ich auf meinen Körper eigentlich besonders große Rücksicht nehmen muss. Und dass ich ein Umfeld brauche, indem ich barrierefrei arbeiten kann. Doch so wie der Wissenschaftsbetrieb derzeit funktioniert, ist das für mich so gut wie unmöglich. Ich wusste, nach drei Jahren endet meine Stelle, auch wenn meine Betreuerin an dem Forschungsinstitut in Hannover sich wirklich Mühe gegeben hat, diverse Anschlussfinanzierungen für mich möglich zu machen.
Der Druck wurde aber auch mit den beiden Verlängerungen – für je ein Jahr – nicht kleiner. Irgendwann habe ich dann starke Zweifel bekommen, ob ich mir diese Unsicherheit nach der Promotion weiter antun möchte. Ob ich das meinem Körper zumuten möchte. Letztlich hat mir ausgerechnet meine Forschung geholfen, mich für den Ausstieg zu entscheiden.
In meiner Promotion habe ich untersucht, wie inklusiv das Arbeitsfeld Wissenschaft für behinderte und chronisch kranke Akademiker:innen ist. Vieles von dem, was ich dort erhoben und ausgewertet habe, ist mir dann selbst widerfahren. Das hat mich dann schon ziemlich erschrocken. Dennoch war die Entscheidung, die Wissenschaft zu verlassen, nicht einfach. Ich war ja schon Mitte 30 und wusste nicht, ob ich als Arbeitnehmer überhaupt attraktiv bin für Jobs außerhalb der Uni.
Heute bin ich froh, dass ich den Absprung geschafft habe. Seit knapp einem Jahr habe ich nun eine unbefristete Stelle und einen Arbeitgeber, der mir bei meinen Bedürfnissen uneingeschränkt entgegenkommt. Beides sind komplett neue Erfahrungen für mich. Und ich spüre, wie sehr sich mein Körper seither entspannt hat. An manchen Stellen am Kopf wachsen sogar plötzlich wieder Haare nach, das hätte ich nicht gedacht. In die Wissenschaft gehe ich jedenfalls nicht mehr zurück.
Wieland Schwanebeck, 40, arbeitet in Dresden für ein sächsisches Ministerium
Es gibt mehrere Gründe, warum ich heute nicht mehr in der Wissenschaft arbeite. Einer davon ist, dass ich ausreichend Zeit mit meiner Familie verbringen möchte. Mittlerweile habe ich zwei Kinder, und meine Frau arbeitet als Lehrerin an einer Grundschule. Meinen Erfahrungen nach wäre das Familienleben mit einer vollen Stelle an der Universität auf Dauer schlechter vereinbar – jedenfalls wenn man sich dort etablieren und seine professorale Eignung nachweisen möchte.
Ich habe mehr als zehn Jahre an der TU Dresden gearbeitet, habe dort promoviert und mich im Anschluss habilitiert. Dabei konnte ich mich in vielerlei Hinsicht sehr glücklich schätzen, was das Umfeld, die Betreuung und meine Vertragssituation anging – ich wurde dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter zweimal über jeweils sechs Jahre angestellt, mehr ging nicht. Da sich an vielen kleineren Instituten die Arbeit in der Regel aber auf wenige Schultern verteilt, verläuft die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit in der Regel sehr fließend.
Das macht man als junger Wissenschaftler aus ehrlicher Begeisterung fürs eigene Fach heraus auch mit, umso mehr, wenn man Teil eines Teams ist, wenn man einen großen Vertrauensvorschuss bekommt und fürs eigene Fach und die Lehre brennt. Aber dass es keine festen Wochenenden und insgesamt wenig Freizeit gibt, ist schwer mit dem Familienleben unter einen Hut zu bringen.
Wer sich als junger Wissenschaftler einen Namen machen möchte, akzeptiert das in der Regel – und ich selbst habe in dieser Hinsicht auch nicht zu leiden gehabt. Aber fürs Familienleben wäre es auf Dauer eine Zumutung, wenn man sich immer nur schlechten Gewissens Zeit freischaufelt, weil im Hinterkopf immer noch ein Projektantrag oder ein Aufsatz herumspukt, an dem man eigentlich gerade schreiben könnte. Diese Trennung kriegen andere Kolleginnen und Kollegen natürlich auch hin, aber mir ist sie sehr schwergefallen. Eine Zeit lang habe ich meine Dienst-Mails der Einfachheit halber in meinen privaten Posteingang umgeleitet, mir kam das ganz normal vor.
Es gibt aber noch andere Gründe, die mein Bild über den Arbeitgeber Hochschule ins Wanken gebracht haben. Allen voran der zunehmende Stellenwert von Drittmitteleinnahmen. Wenn man in einer Berufungskommission sitzt und dann erlebt, dass das Engagement in Lehre und Forschung gegenüber dem Drittmittelaufkommen generell die zweite Geige spielt, schluckt man daran schon ein wenig schwer.
Natürlich sind Forschungskooperationen und Projekte nicht unwichtig, um die Eignung der Bewerber festzustellen. Aber es führt auch dazu, dass viele Forschungsvorhaben vor allem daran ausgerichtet werden, was aktuell als förderfähig gilt – und junge Wissenschaftler müssen sich damit arrangieren, dass ihr berufliches Fortkommen in der Hand einiger weniger Fördereinrichtungen liegt, deren Entscheidungen nur wenig transparent sind. All das hat mich daran zweifeln lassen, ob mein Platz wirklich dauerhaft in der Wissenschaft ist. Gerade weil das Lehrengagement in den Berufungsverfahren eine eher untergeordnete Rolle spielt.
Dazu kommt eine an den Unis aus der Zeit gefallene Einstellung zum Thema Dauerstellen. Die Unterstellung, dass Jobsicherheit innovationsfeindlich ist oder Menschen dazu verleitet, das Arbeiten einzustellen, scheint mir dort recht verbreitet. Das finde ich weltfremd. All diese Punkte haben irgendwann dazu geführt, dass ich mir eine andere Arbeit gesucht habe – auch wenn mir das nicht leicht gefallen ist.
Seit bald drei Jahren bin ich jetzt raus aus der Wissenschaft. Ab und an bedaure ich das auch noch, vor allem das Unterrichten fehlt mir. Gleichzeitig weiß ich: So viel wie jetzt hätte ich mich vor vier, fünf Jahren nicht um meine Kinder kümmern können. Und mir macht meine neue Arbeit Spaß, auch wenn sie nur wenig mit meiner früheren Tätigkeit als Wissenschaftler zu tun hat.






Leser*innenkommentare
fly
Laut Überschrift werden Alternativen aufgezeigt. Wenn das die anderen Lebenswege sind, ok, aber für die Unis wird nichts Neues hinzugefügt.
"Unis aus der Zeit gefallene Einstellung zum Thema Dauerstellen. Die Unterstellung, dass Jobsicherheit innovationsfeindlich..."
Sorry, das für einen habilitierten Menschen wenig durchdacht. Man möchte, klar, eine Dauerstelle haben. Aber es gibt pro Professur nur 0,5 bis 1, selten 2-3 Stellen. Wenn mit Professurantritt (erstes Beispiel 47 Jahre), die Stellen mit jungen Leuten besetzt werden, dann sind die a) 30-40 Jahre besetzt und b) hat die Nachfolge keine Mitarbeiterstelle.
Die durch Projekte geförderten Stellen sind logischerweise befristet - sonst gäbe es weniger Weiterentwicklung und Projektförderung müsste langfristig auf Stellen verzichten.
Es gibt schlicht zu wenig Stellen für alle Interessierten und wäre auch nicht leistbar.
Notizen aus Taiwan
Die klügsten Menschen stellen sich hier an als könnten Sie keine Statistiken interpretieren.
Von 100 promovierenden schaffen es halt je nach Fach nur ca. 5% zur prof stelle. Das weiß JEDER und ist auf der ganzen Welt ähnlich.
Wenn man nun zu den 5% gehören will muss man hart arbeiten oder man sucht sich halt was anderes.
Und ob man zu den 5% gehört zeichnet sich früh ab, bekommt man individuelle Forschungsgelder und finanziert sich Selbst (dahinter steht natürlich meist immer noch der Steuerzahler) oder wird man von einem Prof durchgefüttert?
StefTack
Was mich immer wieder sehr ärgert ist, dass sowohl die VertreterInnen der Wissenschaft als auch der Presse hier immer wieder viel zu viel in einen Topf werfen, statt zumindest ansatzweise zu differenzieren. Es macht nämlich einen sehr großen Unterschied, um welches Fach es geht und um welche Stufe der Karriereleiter. Nur WILL man das offenbar immer weniger zur Kenntnis nehmen. In vielen sog. Geisteswissenschaften bekommt man WiMi-Stellen inzwischen nachgeschmissen, wenn man auch nur ansatzweise was drauf hat. Ich kenne diverse Verfahren aus verschiedenen Disziplinen, in denen es maximal 2, manchmal auch nur eine/n taugliche/n Bewerber/in gab. Und selbst bei Professuren ist es zumindest in den Philologien inzwischen nicht selten so, dass zumindest in der Linguistik und in der Didaktik schon eine Dissertation und wenige Aufsätze reichen, um mindestens zum Vorsingen für eine Professur eingeladen zu werden. Klar ist das z.B. in der Literatur oft anders, weil Kollegs und SFBs halt viele Promovierte "produzieren", die dann weiter miteinander konkurrieren. Aber es hilft niemandem, wenn bis zur Professur führende akademische Karrieren pauschal als unmöglich bzw. unrealisierbar dargestellt werden. Das stimmt nämlich so einfach nicht. Vielmehr wusste damals schon mein Prof im Soziologiestudium im Grundkurs Markoökonomie: "Es kommt darauf an!"
Andere Meinung
Sorry - hier wird den Universitäten eine völlig falsche Aufgabe zugeordnet.
Ich war nach dem Diplom auch einige Jahre an der Uni bis ich meine Dissertation abgeschlossen hatte.
Dann muss man aber nunmal nach einem Arbeitgeber suchen, der für diese Art von Tätigkeit und Qualifikation auch Aufträge hat - in der Regel in der freien Wirtschaft.
Die dauerhaft finanzierten Stellen an den Unis sind die Professorenstellen. Jedem steht es frei sich darauf zu bewerben.
Ich halte es für völlig gerechtfertigt, dass weitere Stellen befristet gehalten werden.
Man darf nicht vergessen, dass all diese Personalkosten von der Allgemeinheit getragen werden müssen.
Machiavelli
@Andere Meinung Im Ausland klappt es auch dem Mittelbau Festanstellungen anzubieten. Es gibt Bedarf an vielen Stellen im Mittelbau und wenig an Professoren für den Unterricht und auch für die Forschung braucht man keine Professur. So verliert halt Deutschland seine klügsten Köpfe weil die ins Ausland gehen.